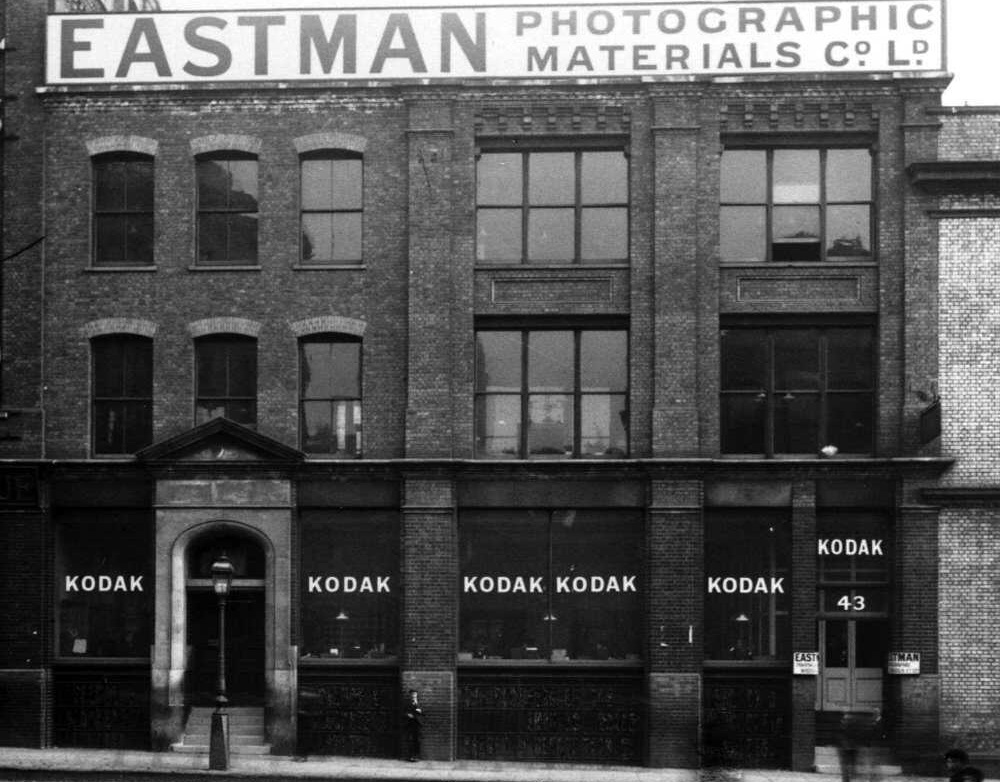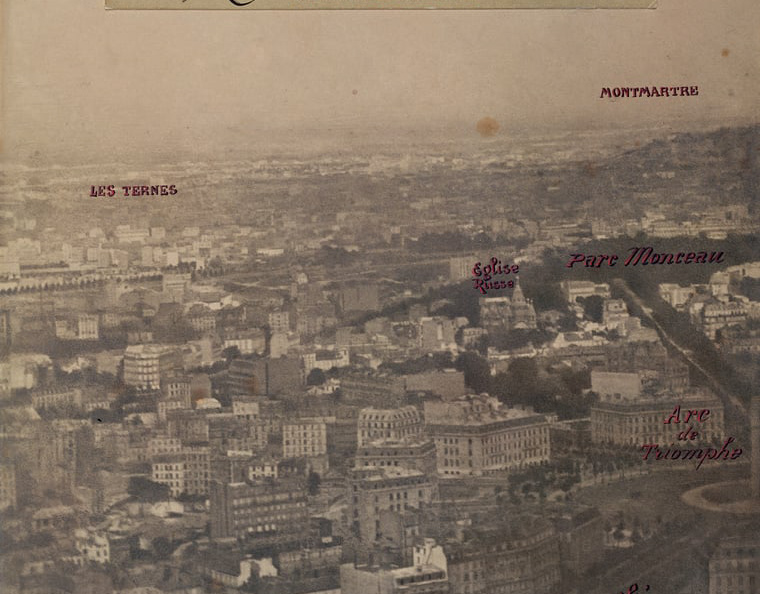Eigentlich war die Fotografie schon lange tot gesagt. Der ständig steigende Bedarf an Silber für fotografische Materialien führte seit den 1970er Jahren zu Engpässen und immer höheren Silberpreisen. Ein Ende der Spirale war nicht absehbar. Bis weit in die 1990er Jahre verbrauchte die Fotoindustrie rund 50% des weltweit verfügbaren Silbers. Doch dann kam das Ende der klassischen silberbasierten Fotografie schneller als gedacht.
Ab 1985 kamen erste elektronische Aufzeichnungsgeräte wie Camcorder und Still Video Kameras auf den Markt, die Bilder oder Videos analog auf Magnetbändern aufzeichneten und auf handelsüblichen Fernsehgeräten abgespielt werden konnten. Diese Geräte ergänzten zunächst die klassische Fotografie im privaten Bereich. Das allgemeine Interesse an der Fotografie als Massenmedium schien in den 1990er Jahren nachzulassen.
Die Fotografie nach der Fotografie entwickelte in den 2000er Jahren eine eigene Dynamik, die in den beiden Jahren 2003 und 2004 zu einem großen Technologieumbruch führte. Das große Angebot an Digitalkameras, die Weiterverwendung und -verarbeitung der Bilddaten im Computer, neue Möglichkeiten der zentralen Bildspeicherung und Archivierung und vor allem auch die Synergien, die sich zusammen mit dem Internet ergaben, waren Entwicklungen, die den Fotomarkt in eine neue Richtung lenkten.
Die digitale Fotografie steigerte in den 2000er Jahren die Bildauflösung der Digitalkameras immer weiter. Im Jahr 2004 galten hochwertige Kameras mit fünf Megapixel bereits als Standard. Die meisten professionellen Fotografen fotografieren seit 2010 digital - viele auch gezwungenermaßen, mangels der Verfügbarkeit analoger Materialien. Die Anhänger der Schwarzweißfotografie benutzen Photoshop, um aus digitalen Bildern Schwarzweiß-Fotos zu machen, die im Digitaldruck wiederum auf klassischen Schwarzweißpapieren gedruckt werden können.
Die Umstellung auf digitale Bilderfassung bedeutete zwar eine neue Herstellungsweise, aber zunächst kein neues Ergebnis. Am Ende des Prozesses stand immer ein fotografisches Bild, meist auf Papier.
Während bei der analogen Fotografie der Grad der Schwärzung der fotografischen Schicht kontinuierlich mit der Stärke des Lichteinfalls zunimmt, werden digitale Bildinformationen als graduelle Helligkeits-stufen gespeichert. Für jeden Bildpunkt und für jede Grundfarbe werden typischerweise 256 Abstufungen (8 bit) verwendet. Das sind mehr, als das menschliche Auge unterscheiden kann. Mit der Variation der drei Grundfarben kann jeder Datenpunkt, also jedes Pixel eines digitalen Bildes 16,8 Millionen Farbwerte darstellen, was weit über die Möglichkeiten aller analogen Aufnahmeverfahren hinausgeht.
Während bei der analogen Fotografie der Grad der Schwärzung der fotografischen Schicht kontinuierlich mit der Stärke des Lichteinfalls zunimmt, werden digitale Bildinformationen als graduelle Helligkeits-stufen gespeichert. Für jeden Bildpunkt und für jede Grundfarbe werden typischerweise 256 Abstufungen (8 bit) verwendet. Das sind mehr, als das menschliche Auge unterscheiden kann. Mit der Variation der drei Grundfarben kann jeder Datenpunkt, also jedes Pixel eines digitalen Bildes 16,8 Millionen Farbwerte darstellen, was weit über die Möglichkeiten aller analogen Aufnahmeverfahren hinausgeht.
Schon während der Zeit der Kunstfotografie des Piktorialismus um 1900 hatte man nach Eingriffsmöglichkeiten gesucht, um die Fotografie von der Wirklichkeitsabbildung zu lösen. Seitdem gibt es manipulierte Fotografien. Die digitale Bildbearbeitung hat diese Möglichkeiten erweitert und erlaubt jetzt die Manipulation direkt bei der Aufnahme, um schließlich jede mögliche Transformation der Fotografie zu ermöglichen.
Zunächst haben digitale Verfahren für die Aufnahme und Verarbeitung von fotografischen Abbildungen die historischen analogen Filmmaterialien abgelöst. Aber nicht hier liegt der fundamentale Umbruch in der Fotografie. Das wirklich Neue ist die Art der Verbreitung und Verwertung fotografischer Aufnahmen über soziale Netzwerke im Internet. Der Film als Aufnahmematerial wurde von Digitalsensoren und das Papierbild wurde vom Bildschirm abgelöst. Die Fotografie wurde dematerialisiert. Die Aufnahme, die Verarbeitung und das Betrachten der Aufnahmen erfolgen in virtuellen Räumen und Abgründen des Internets. Die digitalen Fotodaten sind in Clouds gespeichert.
Konnten in der Vergangenheit Fotografien nur als Original-Drucke in Ausstellungen und später in gedruckter Form auch als qualitativ minderwertiger Abdruck in Zeitschriften und Büchern betrachtet werden, wodurch sie nur einem begrenzten Kreis von Betrachtern zur Verfügung standen, ist heute das Internet das bevorzugte Medium der Verbreitung von Fotografien und Ideen, wo sie simultan weltweit für alle Internetnutzer zur Verfügung stehen. Im digitalen Zeitalter der Post-Fotografie werden fotografische Aufnahmen immer und überall für jeden verfügbar.
Fotos werden heute vor allen im Internet verbreitet. Und die meisten bleiben – zum Glück – auch dort. Unvorstellbar, wenn alle über 1 Billion (1 000 000 000 000) seit 2018 jährlich, meistens mit Smartphones aufgenommenen Fotos auch noch auf Fotopapier ausgedruckt würden. Bei einer üblichen Bildgröße von 10 cm x 15 cm würde diese Menge an Papierbildern über 2 Millionen Fußballfelder voll bedecken. Die digitale Bilderflut ist enorm und setzt ungebrochen einen Trend fort, der mit der Erfindung der Fotografie 1839 begonnen hat: von Jahr zu Jahr werden mehr Fotos aufgenommen!
Wir fotografieren heute alles, was uns umgibt, nach dem Motto: „Fotografiere dein Leben! Wenn du es verlierst, hast du immer noch die Fotos!“ Die digitale Bilderflut bildet eine Art allzeit vorhandenes Hintergrundrauschen unseres Alltags.
Die Fotografie ist heute nicht mehr elitär, sondern integrierter Teil des täglichen Lebens. Jeder kann mitreden und mitbewerten. Jeder ist gleichzeitig Künstler, Galerist und Kunstkritiker. Die Fotografie wurde zu einer globalen Kommunikationsform, die überall auf der Welt verstanden wird. Bilder sind auch über Sprachgrenzen hinweg austauschbar.
Künstlerisch orientierte Fotografen wählen als Medium zur Publizierung gerne das Format des Fotobuchs, bevor sie schaffen, in großen Galerien oder Museen ausgestellt zu werden. Fotobücher werden inter-national auf zahlreichen spezialisierten Messen ausgestellt und vertrieben. Die 2012 ins Leben gerufenen Paris Photo-Aperture PhotoBook Awards zum Beispiel zeichnen Bücher in den Kategorien Erstes Fotobuch, Fotobuch des Jahres und Fotokatalog des Jahres aus.
Plattformen wie WhatsApp, TikTok und andere helfen bei der privaten Kommunikation und beim Austausch von Ideen. Für die Verwertung von professionellen Fotos stehen internationale Agenturen zur Verfügung gestellt werden. Zu den wichtigeren Fotoagenturen gehören Getty Images oder ShutterStock und iStock für lizenzfreie Inhalte. Historisch waren es die Internet Plattformen Facebook und Instagram, die den Trend zum Austauschen von Fotos über das Internet begründeten.
Das Internetportal Facebook wurde 2004 gegründet. Bis heute wurden 250 Milliarden Fotos auf Facebook hochgeladen und werden aktuell von 2,3 Milliarden Nutzern geteilt. Facebook ist allerdings kein eigentliches Fotoportal. Die Fotos sind nur schmückendes Beiwerk der persönlichen Selbstdarstellung.
Der Internet Fotodienst Instagram wurde 2010 gegründet und gehört mittlerweile zu Facebook. Mehr als 1,4 Milliarden Nutzer (Stand 2023) laden ihre Fotos oder Videos hoch und teilen sie mit ihren Abonnenten oder ausgewählten Freunden. Insgesamt 50 Milliarden Fotos wurden bis 2020 geteilt. Instagram ist das beliebteste Foto-Sharing-Portal im Netz und besticht mit seinen vielen Bildfiltern, die auf die Benutzung von Smartphones ausgelegt sind. Gut ist, wer mehr als eine Million Follower hat.
SmugMug ist ein für den Fotografen kostenpflichtiger kalifornischer Fotodienst mit über 100 Millionen Nutzern, die 10 Milliar-den Fotos teilen. SmugMug wurde 2002 gegründet und bietet den meist professionellen Fotografen Dienstleistungen mit vier verschiedenen Stufenmodellen an. Auch der kostenlose Internet Bilderdienst Flickr mit seinen 60 Millionen Nutzern gehört seit 2018 zu SmugMug.
Die Blogger sind die sensationslüsternen Bildreporter der digitalen Zeit. Die Inhalte der Stories selber sind dieselben geblieben und decken alle Bereiche des täglichen Lebens ab von Kriegsberichten über Sozialdokumentation, Sportfotografie, Fashion und Porträts berühmter Persönlichkeiten. Was sich geändert hat, ist er Weg der Verbreitung von fotografischen Inhalten, der jetzt zum Großteil über soziale Netzwerke im Internet erfolgt.
UND JETZT? IPHONEOGRAPHY ODER POSTPHOTOGRAPHY?
In Hinblick auf den Silberverbrauch hatte der konventionelle analoge Fotomarkt 1999 seinen Höhepunkt mit einem geschätzten jährlichen Gesamtverbrauch von 267 Millionen Feinunzen Silber erreicht, was 8.300 Tonnen Silber entspricht. Recycling wurde immer wichtiger und gewann einen großen Teil des Silbers aus den Abwässern der fotografischen Industrie wieder zurück.
Für Kunsthistoriker, Sammler, Museen und Galerien ist die klassische, analoge Fotografie mittlerweile ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Die Produktion von silberbasierten Fotomaterialien ist fast vollständig zum Erliegen gekommen, von Nischenanwendungen für Liebhaber abgesehen.
In der Anfangszeit der Fotografie in der Mitte des 19. Jahrhunderts hatten Künstler Angst davor, dass eine Maschine, also eine Kamera, das Bild eines Menschen oder einer Landschaft machen und damit einen Maler oder Zeichner ersetzen konnte. Mit den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz kommt diese Angst heute zurück. Maschinen können Bilder machen, die weit über das Vorstellungsvermögen der Menschen hinaus gehen. Das Wort „real“ verliert seine Bedeutung.
Die ästhetische Geschichte der Fotografie war schon immer ein Spiegel ihrer technologischen Entwicklung. Technische Neuerungen eröffneten ständig neue künstlerische Gestaltungsräume. Je bedeutender die Innovation, desto kraftvoller war die darauffolgende kreative Expansion.
Der Übergang von der klassischen analogen Fotografie und ihren chemiebasierten Verfahren zu digitalen Bearbeitungs- und Aufnahme-verfahren verlief im professionellen Sektor fließend über mehrere Jahrzehnte hinweg. Digitale Bildbearbeitung veränderte zunächst nur die Arbeit in der Labortechnik zum Anfertigen von Papierabzügen durch die Einführung von hybriden Verfahren, die seit den 1980er Jahren digitale und analoge Verfahren kombiniert in Großlaboren einsetzten.
Der Übergang von der klassischen analogen Fotografie und ihren chemiebasierten Verfahren zu digitalen Bearbeitungs- und Aufnahme-verfahren verlief im professionellen Sektor fließend über mehrere Jahrzehnte hinweg. Digitale Bildbearbeitung veränderte zunächst nur die Arbeit in der Labortechnik zum Anfertigen von Papierabzügen durch die Einführung von hybriden Verfahren, die seit den 1980er Jahren digitale und analoge Verfahren kombiniert in Großlaboren einsetzten.
In den 1990er Jahren wurde die digitale Bildbearbeitung am Heimcomputer möglich durch die Einführung der Software photoshop (heute: Adobe photoshop). Seit der Jahrtausendwende wurde der Kameramarkt innerhalb eines Jahrzehnts auch im professionellen Bereich komplett durch digitale Aufnahmegeräte ersetzt.
Der Siegeszug der Smartphones begann 2010 und ermöglichte es jedem Nutzer auf der Welt, Fotos aufzunehmen und mit anderen Nutzern zu teilen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Smartphones ermöglicht seit 2015 die Bildbearbeitung und -verbesserung direkt bei der Aufnahme.
Es ist noch zu früh, um die Auswirkungen der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz abzusehen. Der Begriff Postfotografie wurde erstmals von dem amerikanischen Kunsthistoriker Geoffrey Batchen in seinem 2000 erschienenen Buch „Burning with Desire: The Conception of Photography" verwendet. Batchen argumentierte, dass die digitale Revolution die Fotografie in eine neue Ära geführt hat, in der die traditionellen Vorstellungen von Fotografie als einem objektiven Abbild der Realität nicht mehr gelten. Der Begriff Postfotografie beschreibt die vielfältigen Veränderungen in der Fotografie seit dem Aufkommen der Digitaltechnik. Die Postfotografie ist eng mit der Digitaltechnik verbunden. Digitale Kameras und Bildbearbeitungsprogramme haben die Art und Weise, wie wir fotografieren und Bilder bearbeiten, auf eine neue Ebene gehoben.
Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz für die Erzeugung von Abbildungen, die wie Fotos aussehen, wurde die Kamera überflüssig. Diese „kameralose Fotografie“ führte zu einem revolutionär neuen Verständnis über das Wesen der Fotografie. Neue Formen der künstlerischen und kommerziellen Fotografie werfen grundsätzliche Fragen und Bedenken hinsichtlich der Authentizität und Glaubwürdigkeit von Bildern auf.
DIE ZUKUNFT DER FOTOGRAFIE OHNE FOTOGRAFIE?
So wie die Einführung von Maschinen im 18. Jahrhundert die Welt der Arbeit revolutionierte, so wird die Entwicklung von KI gesteuerten Algorithmen die Wahrnehmung und die Gestaltungsmöglichkeiten der Welt im 21. Jahrhundert grundlegend verändern.
Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) wurde 1955 erstmals eingeführt und bezeichnet heute Algorithmen und Modelle, die automatisiert Operationen durchführen können – Erkennung, Klassifizierung, Vorhersage, Analyse und Datengenerierung – und unzählige Anwendungsmöglichkeiten bieten. Seit Ende der 2000er Jahre haben diese Algorithmen und Modelle alle Ebenen von Kultur und Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Militär durchdrungen. Ihr Einsatz wirft überall vielfältige ethische, erkenntnistheoretische, politische und geopolitische Fragen auf, insbesondere da sie enorme materielle und ökologische Ressourcen beansprucht.
Die Künstliche Intelligenz hat in den 2010er Jahren begonnen, auch die alltägliche Fotografie in vielfältiger Weise zu beeinflussen, zunächst in der Bildbearbeitung und -verbesserung, Zunehmend wichtig werden Themen wie automatisierte Fotografie, Objekt- und Gesichtserkennung, generative Verfahren zur Bilderzeugung, virtuelle und erweiterte Realität.
Die Generative KI geht noch einen Schritt weiter und generiert über einen Algorithmus fotografische Abbildungen, oder – besser gesagt – Abbildungen, die aussehen wie Fotografien. Die Nutzung generativer KI wirft ethische Fragen und Herausforderungen im Bereich des Urheber-rechts auf. Wer ist der Urheber eines von KI generierten Bildes? Wie können wir sicherstellen, dass generative KI verantwortungsvoll ein-gesetzt wird? Insgesamt bietet generative KI enormes Potenzial, die Fotografie und verwandte visuelle Künste zu revolutionieren. Durch den Einsatz von KI werden die Möglichkeiten der Fotografie ins Unendliche erweitert. In diesem Zusammenhang spielen Bilder eine entscheidende Rolle: Der Einfluss von KI auf zeitgenössische künstlerische Praktiken und die visuelle Kultur im Allgemeinen gehört zu den sichtbarsten Phänomenen in einem Umfeld, das weitgehend von diskreten Operationen, unsichtbaren Prozessen und Black Boxes dominiert wird. KI-Technologien verändern die Art und Weise, wie Bilder aufgenommen, erstellt, verändert, verbreitet, beschrieben und betrachtet werden, grundlegend.
Seit den 2010er Jahren hinterfragen viele Künstler den wachsenden Einfluss der KI in unseren Gesellschaften und erforschen diese Umbrüche mithilfe unterschiedlicher Medien.
Seit den 2010er Jahren hinterfragen viele Künstler den wachsenden Einfluss der KI in unseren Gesellschaften und erforschen diese Umbrüche mithilfe unterschiedlicher Medien.
Während „echte Fotos“ als Helligkeitsabdruck mit Hilfe von Licht in einer Kamera entstehen, sind KI-generierte Bilder keine Fotografien und sollten auch nicht so bezeichnet werden, auch wenn sie durch ihre fotorealistische Darstellung diesen Eindruck vermitteln (Abbildung: Fahrradkurier, erzeugt mit dem Programm Firefly ▲). KI-Programme wie Firefly von Adobe erzeugen Bilder, indem sie auf riesige „Datensätze“ bereits vorhandener Bilder zurückgreifen. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und erweitern die Möglichkeiten der klassischen Fotografie in nie dagewesener Weise.
Künstlich generierte Bilder, die von generativen KI-Modellen, den so genannten GANs (Generative Adversarial Networks) erzeugt werden, eröffnen neue kreative Möglichkeiten, werfen aber auch ethische und rechtliche Fragen auf, insbesondere in Bezug auf Urheberrecht und Authentizität. Auch die Möglichkeiten der klassischen Fotobearbeitungssoftware werden durch generative KI-Modelle erweitert und schaffen neue kreative Werkzeuge. Dies hilft auch, historische Fotos zu rekonstruieren oder zu verbessern, indem fehlende Teile ergänzt oder die Auflösung erhöht wird. Dies könnte für Archivare und Historiker von großem Wert sein.
Auch die oft automatisch erfolgende Bildverbesserung, die in jedem Smartphone stattfindet, entfernt die fotografische Abbildung zunehmend von der Realität. Ein grauer Himmel wird blau, ein faltiges Gesicht wird glatt gebügelt. Störende Gegenstände oder Personen werden aus den Bildern entfernt.
Der Begriff „echtes Foto“ ergibt in Zeiten der Künstlichen Intelligenz keinen Sinn mehr. Mit Hilfe der generativen KI werden auf Basis von Milliarden aufgenommener Bilder Darstellungen erzeugt, die aussehen wie ein „echtes Foto“. Ein generatives Bild verletzt unseren Realitäts-sinn nicht unbedingt, weil es dem Dargestellten zu sehr oder zu wenig ähnelt, sondern weil es uns dazu verleitet, einer synthetischen Darstellung eine bestimmte Aussage und eine Wirkung zuzuschreiben.
Die Fotografie als „Zeuge der Wahrheit“ ist obsolet. Der katalanische Fotograf Joan Fontcuberta argumentiert, dass die Fotografie spätestens im Zeitalter digitaler Bildmanipulation, insbesondere durch KI, ihren Status als „Beweismittel“ verloren hat. KI-generierte Bilder simulieren fotografische Realität so überzeugend, dass der Unterschied zwischen „fotografischem Bild“ und „synthetischem Bild“ verschwindet. Dies untergräbt das traditionelle Vertrauen in die Fotografie als Medium der Dokumentation.
Fontcuberta spricht schon seit Jahren von der Postfotografie – einem Zustand, in dem Bilder nicht mehr primär aufgenommen, sondern generiert, kuratiert und manipuliert werden. KI geneierte Bilder sind für ihn ein logischer nächster Schritt in dieser Entwicklung: Die Kamera verliert weiter an Bedeutung. Es sind jetzt Algorithmen und Datenmodelle, die neue Bildwelten erzeugen.
Was als real erlebt wird und was „authentisch“ wirkt, beruht auf überzeugenden Details. Realismus ist keine Dokumentationsform, kein Grad an Genauigkeit, sondern eine Reihe von Konventionen. Ein Deepfake spielt mit der Idee, dass viral Gemachtes immer realer erscheint, bis es durch häufige Wiederholung und Berichterstattung eine Art Gewissheit erlangt. Die Bekanntheit eines Bildes wird zu seinem Hauptkontext und macht es zum „realen“ Objekt.
Auch der Medienkontext beeinflusst unser Verständnis, wie wir die „Realität“ sehen und in Bildern nach bekannten Mustern suchen. Die Bilder, die am weitesten verbreitet sind, sind nicht die „realsten“, sondern diejenigen, die auf Aufmerksamkeit optimiert sind, wie zum Beispiel Deepfakes von bekannten Persönlichkeiten. Mit dem Übergang vom Lichtbild zum Datenbild geht auch die Abschaffung des Autors, der Autorin einher.
Zwei Bildwelten stehen sich gegenüber, auf der einen Seite die Fotografie mittels Kamera, auf der anderen die Bilderzeugung mittels Computer, hier das Lichtbild, dort das mit Hilfe von Algorithmen generierte Datenbild. Authentische Fotografie, die die Welt möglichst unverfälscht wiedergibt, wird wohl auch weiterhin ihre Berechtigung haben, überall dort, wo dokumentarisch über Themen berichtet werden soll, von Ereignissen im privaten Umfeld über Umweltberichterstattungen bis hin zu Reportagen über reale Menschen und ihre sozialen und gesellschaftlichen Konflikte.