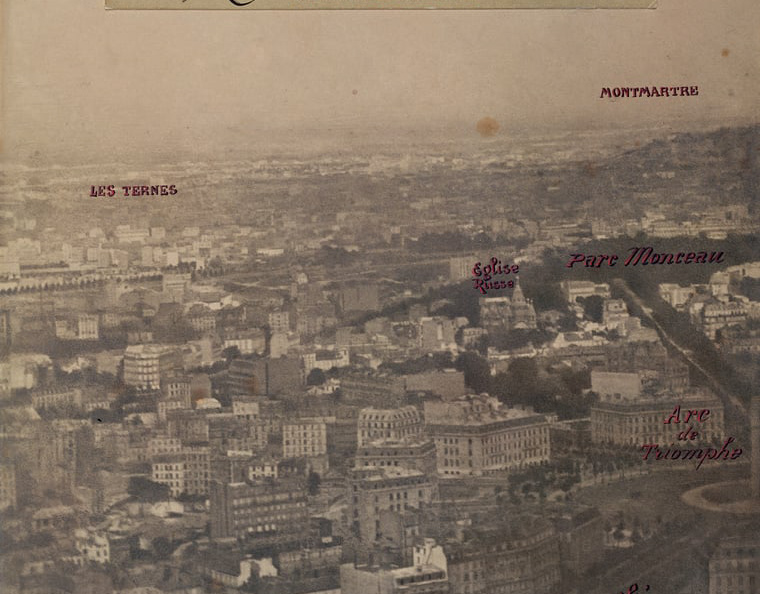Auch interessant: Fotografie in Superlativen
Am Anfang war die Fotografie eine schwerfällige und wenig inspirierende Angelegenheit. Die ersten Fotos waren düstergraue Abbildungen einer leblosen Wirklichkeit. Wer fotografiert werden wollte, musste oft minutenlang unbewegt still halten. Und doch hat keine Erfindung die Menschheit so sehr inspiriert wie die Fotografie und die Fotografie zu einer Schlüsselerfindung der Menschheitsgeschichte gemacht.
Die ersten fotografischen Versuche wurden bereits in den 1820er Jahren von Hobbyforschern und Privatiers durchgeführt. Diese „Dilettanten“ verfügten über keine besonderen wissenschaftlichen oder künstlerischen Fähigkeiten. Es war die reine Lust am Experimentieren und der Glaube an die Möglichkeiten der Technik, die sie antrieb. Die meisten dieser frühen fotografischen Versuche basierten auf der Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen, die schon seit Ende des 18. Jahrhunderts bekannt war.
Erste Versuche lieferten Schattenbilder von Gegenständen, die auf lichtempfindlich gemachtes Papier gelegt wurden und dort durch Lichteinwirkung so genannte "fotogenische Zeichnungen" erzeugten.
Das Prinzip der Kamera, die bereits seit dem 16. Jahrhundert als Camera Obscura zum Abzeichnen der Natur oder von Bauwerken benutzt wurde, hat schon früh den Wunsch nach einer automatischen Methode zum Aufzeichnen der erhaltenen Bilder geweckt. Zusammen mit der Kenntnis von chemischen Stoffen, die sich durch Lichteinwirkung verfärben, wurden am Anfang des 19. Jahrhunderts die ersten Versuche gemacht, die dann 1839 in den ersten fotografischen Verfahren mündeten.
Daguerre Kamera (rechts) mit Zubehör und Chemikalien zum Beschichten und Entwickeln der Fotoplatten, 1839
Der offizielle Geburtstag der Fotografie ist der 19. August 1839
An diesem Tag präsentierte der französische Physiker François Arago das von Louis Daguerre entwickelte und nach ihm benannte Verfahren der Daguerreotypie in einer Sitzung der Pariser Akademie der Wissenschaften und der schönen Künste der Öffentlichkeit. Dieser Tag markiert zwar nicht den eigentlichen Tag der Erfindung der Fotografie, aber einen wichtigen Meilenstein in der weltweiten Verbreitung der Fotografie als „Geschenk an die Welt“, wie damals vom französischen Staat formuliert wurde.
Drei große Perioden prägten die Geschichte der Fotografie:
1. Die Epoche der Pioniere, die noch all ihre Materialien und Gerätschaften selber herstellen und erfinden mussten, dauerte von den ersten Anfängen bis 1880. Landschaftsfotografie, Stillleben, Reisefotografie und Porträtfotografie waren die dominierenden Betätigungsfelder der Fotografen dieser Zeit. Die erhaltenen Fotografien wurden im privaten Umfeld gesammelt und in gemeinsamen Ausstellungen in fotografischen Vereinigungen gezeigt.
2. Die Industrialisierung der Fotografie brachte ab 1880 industriell hergestellte Aufnahmematerialien, Fotopapiere und Kameras, die jetzt die Fotografie auch einer wachsenden Zahl von begeisterten und engagierten Amateuren zugänglich machte. Diese Periode der Fotografie entwickelte sich stilistisch vom ma-lerisch inspirierten Piktorialismus, über die surrealistische und grafisch orientierte Fotografie der Moderne zum allgegenwärtigen Fotojournalismus, der auch die Modefotografie, Porträt- und Gesellschaftsfotografie umfasste. Die Fotografie wurde durch das Abdrucken in Zeitschriften mit großen Auflagen vervielfältigt und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Die Fotografie war jetzt für viele Menschen das Fenster zur Welt.
3. Die Demokratisierung der Fotografie folgte in den 1960er Jahren mit der Einführung zunehmend elektronisch gesteuerter Kameras, die die Belichtungseinstellungen automatisch vornahmen. Neuartige farbfotografische Materialien und Verfahren lieferten jetzt perfekte Bildergebnisse für alle Nutzer, Amateure wie Profifotografen. Die Fotografie hatte die Phase der Emanzipation erreicht. Sie stand jetzt für sich selber und war Medium und Akteur gleichzeitig in allen Bereichen des täglichen Lebens. Die Fotografie wurde jetzt auch in großen Museen sichtbar und selbstverständlicher Bestandteil der Kunstwelt. Elektronisch gesteuerte Kameras und die Anfänge der digitalen Bildverarbeitung führten schließlich zur Digitalfotografie. Mit der Verbreitung der Smartphones wurde die Fotografie allgegenwärtig und es gibt nichts mehr, was nicht fotografiert wird und niemanden, der nicht fotografiert.
Die frühen Pioniere der Fotografie benutzten hölzerne Kameras und stellten ihre Ausrüstungen und Materialien größten Teils selbst her. Optiker, die eigentlich auf die Herstellung von Brillen und Ferngläsern spezialisiert waren, lieferten die Objektive. Die ersten wichtigen Verfahren der Fotografie stammten vom Franzosen Louis Jacques Mandé Daguerre und vom Engländer William Henry Fox Talbot.
Für die ersten fotografischen Versuche und Verfahren wurden zunächst verschiedene Bezeichnungen als Oberbegriff verwendet wie Heliografie, fotogenische Zeichnung (engl.: photogenic drawing) oder in frühen deutschen Texten auch Lichtzeichenkunst, woraus sich später die immer noch gebräuchliche Bezeichnung „Lichtbild“ ableitete.
Der Begriff „Fotografie" wurde zum ersten Mal 1839 vom englischen Wissenschaftler John Herschel (1792–1871) in einem Brief an Fox Talbot verwendet. Herschel bevorzugte die Bezeichnung „photographic“ vor dem bis dahin von Talbot verwendeten „photogenic“. Herschel prägte auch die Begriffe „Positiv" und „Negativ" als Umschreibung für Talbot’s zweistufiges Verfahren, das zunächst in der Kamera ein Negativ erzeugte, das dann in einem zweiten Schritt zu einem Positiv umkopiert wurde und damit das Vervielfältigen der fotografischen Aufnahmen ermöglichte. Außerdem machte er die ersten fotografischen Aufnahmen durch den von ihm gefundenen Fixierprozess mit Natriumthiosulfat haltbar, der in der Folgezeit für alle fotografischen Verfahren angewendet wurde.
In den 1850er Jahren wurden die fotografischen Verfahren in ihrer Qualität deutlich verbessert. Als Träger für das Aufnahmematerial wurden jetzt Glasplatten verwendet, die mit Kollodium als Haftschicht für die lichtempfindliche Emulsion überzogen waren.
Daguerreotypie Porträt eines Ehepaars in einem für die Zeit typischen Rahmen, 1839
Fotografische Aufnahmen konnten in den ersten 50 Jahren der Fotografie nur von Spezialisten hergestellt werden, die die lichtempfindlichen Materialien selber herstellen und verarbeiten konnten. Die Belichtungszeiten der Aufnahmen lagen bei mehreren Sekunden bis zu mehreren Minuten, was die Auswahl der möglichen Motive stark einschränkte. Erste beeindruckende Aufnahmen entstanden im Bereich der Porträtfotografie und der Landschaftsfotografie.
Ab 1880 begann die industrielle Produktion einer neuen Generation von Fotoplatten als Aufnahmematerial, die vor allem lichtempfindlicher und endlich auch lange Zeit haltbar waren. Jetzt konnte grundsätzlich überall fotografiert werden. Die belichteten Fotoplatten konnten auch Tage oder Wochen später noch in einem Fotolabor entwickelt werden. Die Fotografie wurde mobil. Außerdem konnten durch Belichtungszeiten von Bruchteilen einer Sekunde Bewegungen scharf abgebildet werden, was zum ersten Mal auch das Fotografieren aus der Hand ermöglichte. Mit diesen neuartigen Momentaufnahmen gelangte die Fotografie in den Alltag der Menschen und in ihre soziale Umgebung am Arbeitsplatz oder auf der Straße.
Kodak ermöglicht die Amateurfotografie mit der Kodak Kamera, 1888
Die beginnende Amateurfotografie brachte ab 1888 mit industriell hergestellten, preiswerten Kameras für neuartige Rollfilme auf Zelluloidbasis die Fotografie auch in das Privatleben der Menschen, die sich nun selber abfotografieren konnten ohne die Hilfe eines professionellen Fotografen. Die ersten Amateurkameras von Kodak lieferten übrigens runde Bilder.
Die 1920er und 1930er Jahre brachten neue Kameras aus deutscher Produktion wie die Leica und die Contax Kleinbildkameras für 35mm Kinofilm oder die Rolleiflex für Rollfilm im legendären Aufnahmeformat 6 cm x 6 cm. Durch zunehmende Verwendung von flexiblen Filmmaterialien anstelle von starren Fotoplatten aus Glas wurde die Fotografie endlich beweglich und leicht.
In den 1930er Jahren begann die große Zeit des Fotojournalismus. Illustrierte Zeitschriften und Tageszeitungen entdeckten die Fotografie als wichtigstes Kommunikationsmedium und wurden in den 1930er Jahren zur Plattform ganzer Heerscharen von Fotojournalisten. Reportagen über soziale Missstände, Streiks oder die Armut in breiten Teilen der Bevölkerung wurden durch die Fotojournalisten neben klassischen Themen wie Politik, Krieg, Mode und Lifestyle in eine breite Öffentlichkeit getragen. Große illustrierten Zeitschriften berichteten jetzt über die „ganze Wahrheit". Die Fotografie wurde politisch und polemisch.
Während der 1960er begann ein weiterer großer Umbruch im Kameramarkt, der bis dahin von deutschen und US-amerikanischen Herstellern dominiert war. Japanische Unternehmen begannen mit zunehmend elektronisch gesteuerten Kameras den Markt zu dominieren. Insbesondere japanische Spiegelreflexkameras von Nikon, Olympus, Asahi und Canon überschwemmten in den 1970er Jahren mit nie dagewesenen Produktionszahlen und günstigen Preisen den Weltmarkt. Professionelle Fototechnik war nun auch für Amateure verfügbar.
Mit dem drastischen Sinken der Auflagen der Illustrierten Zeitschriften und Tageszeitungen Ende der 1970er Jahre, verursacht durch den Einzug des Fernsehens als neuer Informationsquelle, suchten viele Fotoreporter nach anderen Betätigungsfeldern. Die Emanzipation der Fotografie zu einem selbstverständlichen und allgemein verfügbaren Medium brachte neue Betätigungsfelder für die Fotografen, die jetzt von großen Fotoagenturen wie Magnum Photos vertreten wurden. Die Fotografie wurde in diesem Kontext auch zu einem künstlerischen Ausdrucksmittel weiterentwickelt, das ganze Museen füllte. Die Themen wurden diverser und internationaler.
Die technische Basis der fotografischen Verfahren war 170 Jahre lang die Verwendung von lichtempfindlichen Materialien auf Basis von Silbersalzen, die auf Lichteinfall reagieren. In den 2000er Jahren wurden die klassischen Silber basierten fotografischen Verfahren durch digitale Aufnahmeverfahren mit elektronischen Bildsensoren abgelöst.
Jedes Jahr werden mehr Fotos aufgenommen. Die Aufnahmen werden automatisch richtig belichtet und scharf gestellt, Motiverkennungsprogramme optimieren die Fotos bereits bei der Aufnahme. Überwachungskameras, Kameras, die für Telekonferenzen benutzt werden, und Action Cams nehmen pausenlos Bilder auf, ohne dass irgendjemand auf einen Auslöser drücken muss. Künstliche Intelligenz durchsucht die Fotos nach relevanten Personen, analysiert die Inhalte und generiert auf Wunsch eigene Bildwelten. Dieser Weg führt direkt zur Fotografie ohne Fotografen und zur „fotografischen“ Bildentstehung ohne Kamera durch generative Datenmodelle der künstlichen Intelligenz.
Künstliche Intelligenz ist das tödliche Virus der Fotografie im eigentlichen Sinne, also in der Bedeutung, Bilder mit Licht aufzuzeichnen. Die Fotografie als das Gedächtnis der Welt ist wird durch den Einsatz von KI unglaubwürdig. Die generative künstliche Intelligenz erschafft Bildwelten, die vor allem in der Werbung, der Illustration und der Mode die Grenzen zur Realität verschwinden lassen. Um es positiv auszudrücken: die Fotografen haben jetzt endlich mehr Zeit, sich ihren eigenen kreativen Projekten zu widmen.
Zum Trost: der Beruf des Fotografen wurde seit dem Jahr 2000 immer beliebter und erlebte einen enormen Zulauf. Die Zahl der fotografischen Ateliers und Handwerksbetriebe alleine in Deutschland wuchs von 4.500 im Jahr 2004 auf fast 40.000 im Jahr 2022. Die Fotografie ist tot. Es lebe die Fotografie!
Die Verbreitung der Fotografie in der Welt
Die Nachricht von der Erfindung der Fotografie verbreitete sich bereits 1839, dem Jahr der Veröffentlichung des ersten Verfahrens von Louis Daguerre, in allen Metropolen der Welt. Die Anleitung für das Daguerreotypie Verfahren wurden noch im ersten Jahr in mehrere Sprachen übersetzt und in mehreren Auflagen gedruckt. Das Verfahren unterlag keinem Urheberschutz und durfte von jedem Fotografen der Welt lizenzfrei angewendet werden.
Neben der einträglichen Porträtfotografie wurde die Fotografie zunächst vor allem im dokumentarischen Bereich eingesetzt, zum Beispiel beim Ablichten von historischen Gebäuden, archäologischen Stätten oder auch entlegenen Landschaften. Überliefert sind Aufnahmen der Pionierzeit insbesondere aus Frankreich, England, Österreich, Deutschland und den USA von Fotografen wie Henry Fox Talbot, Felice Beato, Gebrüder Bisson, Julia Margaret Cameron, Francis Frith, David Octavius Hill und Robert Adamson, Gustave Le Gray, Charles Marville, Eadweard Muybridge, Nadar, Roger Fenton oder Carleton E. Watkins. Erste Fotoausstellungen in fotografischen Gesellschaften und erste Fotobücher, die mit Original-Fotografien illustriert waren, wurden in der Zeit bis 1880 veröffentlicht. Porträtfotos wurden in speziellen Fotoalben gesammelt.
Die Industrialisierung der Fotografie ab 1880 ließ die Zahl der Fotografen durch die bessere Verfügbarkeit von Gerätschaften und lichtempfindlichen Materialien stark ansteigen. Neben der professionellen Fotografie entstand jetzt auch eine große Gruppe von Amateurfotografen. Bis zum Ende der 1920er Jahre gab es wahrscheinlich bereits 20 Millionen fotografierender Menschen weltweit.
Das 20. Jahrhundert wurde zum Jahrhundert der Fotografie. Es steht für den Aufstieg der Fotografie zum wichtigsten Kommunikationsmedium. Künstlerische Ambitionen trieben die Fotografie am Anfang des 20. Jahrhunderts zu neuen Ausdruckformen, umgesetzt von begeisterten Amateurfotografen und experimentierfreudigen Fotokünstlern in der ganzen Welt wie Alvin Langdon Coburn, Alfred Stieglitz, Gertrude Käsebier, Brassaï, Man Ray, Eugène Atget, André Kertész und Adolphe de Meyer.
Die Fotografie blieb lange Zeit die Beschäftigung einer weißen, elitären und vorwiegend männlichen Bevölkerungsschicht. Alleine die Themen änderten sich in den 1920er Jahren, ausgehend von einer neuen Richtung der Fotografie in den USA. Die sozialdokumentarische Fotografie schuf die Grundlage für die Entwicklung der Pressefotografie, die in den 1930er Jahren Fahrt aufnahm. In ihrem Umfeld entwickelte sich die Fotografie zusammen mit der Modefotografie und weiter gefassten Porträtfotografie zu einer neuen, modernen Kunstform. Die großen Fotografenlegenden arbeiteten jetzt für amerikanische Magazine wie Life und Look, Vogue und Harper’s Bazaar und viele andere Zeitschriften und Tageszeitungen. Zu den wichtigen Fotografen dieser Zeit gehörten auch viele Migranten, die in den 1930er Jahren aus politischen Gründen oder als Juden aus Europa fliehen mussten wie Adolphe de Meyer, Erwin Blumenfeld, Robert Capa oder Alfred Eisenstaedt. Die Zeit des Nationalsozialismus und die Folgen des Zweiten Weltkriegs machten Europa für 20 Jahre zu einem fotografischen Niemandsland.
Die wichtigste Institution für die Förderung von Fotografen ist seit den 1930er Jahren das ebenfalls amerikanische Metropolitan Museum of Modern Art, kurz MoMA, in New York, das seit 1930 die Werke von hunderten, meist US-amerikanischer Fotografen aufkaufte und in insgesamt 700 Ausstellungen zeigte. Damit prägte das MoMA bis zum Ende des 20. Jahrhundert das Bild der Fotografie und bestimmte auch über den Marktwert von Fotografen. Die wichtigsten Fotografenlegenden dieses „amerikanischen“ Zeitalters der Fotografie, die vor allem durch Ausstellungen im MoMA berühmt wurden, waren neben anderen Ansel Adams, Berenice Abbott, Diane Arbus, Richard Avedon, Imogen Cunningham, Philip-Lorca diCorcia, William Eggleston, Walker Evans, Clarence H. White, Dorothea Lange, Eadweard J. Muybridge, Edward Steichen, Edward Weston, Garry Winogrand, Harry Callahan, Helen Levitt, Irving Penn, László Moholy-Nagy, Lee Friedlander, Lisette Model, Minor White, Paul Strand, Robert Frank, Stephen Shore oder Weegee (Arthur Fellig).
Seit den 1960er Jahren wurden dann auch einige nicht-amerikanische Fotografen durch große Ausstellungen im New Yorker MoMA bekannt, wie die deutschen Fotografen Bernd & Hilla Becher, Andreas Gurski und August Sander, der Schweizer Bill Brandt, der Mexikaner Manuel Álvarez Bravo, die Franzosen Henri Cartier-Bresson und Florence Henri, die Italienerin Tina Modotti oder der Japaner Shomei Tomatsu.
In den 1970er und 1980er Jahren wurde die Wahrnehmung der Fotografie als Kunstform internationaler, vielschichtiger und diverser. Die Fotografie wurde ein wichtiger Bestandteil privater und öffentlicher Kunstsammlungen der ganzen Welt. Hochbezahlte Fotokünstler wie Cindy Sherman, Jeff Wall oder Andreas Gurski wurden jetzt Stars der Kunstszene. Auch afrikanische Fotokünstler wie Samuel Fosso fanden Anerkennung ebenso japanische wie Eikō Hosoe oder Daido Moriyama.
Vor dem Beginn der japanischen Marktdominanz im Sektor der Kameraproduktion in den 1960er Jahren waren es rund 300 Millionen Menschen, die bereits eine Kamera besaßen, von der einfachen Rollfilmkamera, über Instamatic-Kameras von Kodak bis hin zu diversen Kleinbild- und Mittelformatkameras. Bis zum Jahr 2000 kamen dann noch 200 Millionen Spiegelreflexkameras und 500 Millionen vollautomatische Point and Shoot Kameras dazu. Das ergibt rund eine Milliarde Besitzer klassischer analoger Kameras bis zur Jahrtausendwende.
Die Fotografie als Schlüsselerfindung hat auch neue Industriezweige geschaffen wie die Filmindustrie und das Fernsehen, die moderne Druckindustrie, die fotochemische Industrie, Kamerahersteller, Objektivhersteller und Dienstleister wie Großlabore und Handelsketten. Im digitalen Zeitalter wären Smartphones ohne Kamera unverkäuflich und soziale Netzwerke ohne Fotos sind unvorstellbar.
Die digitale Fotografie benötigt kein Aufnahmematerial in Form von Filmen mehr. Digitale Fotos werden elektronisch in verpixelten Wolken gespeichert. Fotos werden auf Bildschirmen betrachtet. Die Fotografie befindet sich im Zustand der Dematerialisierung. Es können beliebig viele Aufnahmen angefertigt, gespeichert, weiterverteilt und wieder problemlos gelöscht werden, ohne Material zu verschwenden.
Über soziale Netzwerke im Internet sind es unzählige Betrachter, die über die Qualität und Relevanz einer Aufnahme entscheiden, durch die Anzahl von Klicks, Likes und Followern.
Die Bedeutung der Fotografie hat sich seit ihren Anfängen von einem Dokument oder Kunstwerk zu einem universellen Kommunikationsmittel gewandelt, das jedem jederzeit zur Verfügung steht. Der deutsche Bauhaus-Künstler László Moholy-Nagy (1895–1946) brachte es bereits 1929 auf den Punkt: „Nicht der Schriftunkundige, der Fotografie-Unkundige ist der Analphabet der Zukunft.”